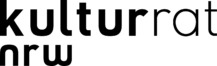Dezember 2021
Inhalt: Bilanz und Ausblick, Pandemie, Umfrage “Kunst und Kultur in der Pandemie”, Kulturpolitische Entwicklung 2021, Vernetzung der Landeskulturräte, Bundeskulturpolitik
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freund*innen der Kunst,
wir melden uns zum Jahreswechsel mit einer Bilanz der letzten Monate und einem Ausblick:
Die Pandemie
Ein zweites Jahr im Zeichen von Covid19 geht zu Ende. Ein Ende der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen ist nicht abzusehen. Die Omikron-Welle erfasst Europa und auch unser Land. Viele Veranstaltungen werden abgesagt. Zum Teil bleibt das Publikum fern. Dem Land droht durch diese hochansteckende Mutante eine neue ernsthafte Gefahr. Kontaktbeschränkungen werden kommen, vielleicht sogar ein erneuter Lockdown.
Wieder erleben wir, dass freischaffende Künstler*innen in Existenznot geraten und den Weg zur Sozialhilfe antreten müssen. Die angestrebte soziale Absicherung wird erst noch von Regierung, Bundestag und Bundesrat behandelt werden. Das braucht Zeit, obwohl sie im Grundsatz politischer Konsens ist. Das Land NRW setzt sich für diese neue Absicherung ein. Ab Januar ist Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen die neue Vorsitzende der Kulturministerkonferenz und wird auch von da aus das Projekt unterstützen.
Was die freischaffenden Künstler*innen betrifft – sie sind von den Einschränkungen am stärksten betroffen. Es müssen jetzt nach unserer Ansicht erneut unverzüglich Entscheidungen zu Überbrückungshilfen erfolgen.
In den verschiedenen Programmen, vor allem denen des Bundes, gibt es zwar Hilfen, die auch den Künstler*innen zugutekommen. Dazu zählt der Sonderfonds Kulturveranstaltungen, der die Risiken der Veranstalter abfedert. Diese Programme sind schon verbessert worden. Das alles sind vor allem indirekte Künstlerhilfen. Deren Beantragung und Abwicklung ist zum Teil kompliziert, zum Teil sind sie Jury-Entscheidungen unterworfen und sie sind in ihrer Dimension beschränkt.
Wir sind der Meinung: Es ist der beste Weg für NRW, die direkt auf die Künstler*innen zugeschnittenen Stipendienprogramme für eine gewisse Zeit wieder aufleben zu lassen. Also wieder von Januar bis Juni für sechs Monate monatlich 1000 Euro. Das erfordert erneut 100 Millionen Euro. Die Finanzierung kann aus dem bislang nicht ausgeschöpften Pandemiefonds des Landes bestritten werden. Mit den beiden bisherigen Stipendienprogrammen hat das Land angesichts dieser großen Herausforderung einer gefährlichen, die Gesellschaft lähmenden Seuche „groß gedacht“ und damit schnell und unbürokratisch wirkliche Hilfe geleistet. Und mit den Stipendien sind ja auch künstlerische Gegenleistungen verbunden, die zum Teil sehr beachtlich sind.
Wirkliche Hilfe muss jetzt schnell und unbürokratisch geleistet werden. Ministerin Pfeiffer-Poensgen erklärt auf unsere Anfrage, dass das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW Fördermaßnahmen prüfe, auch vor dem Hintergrund einer sich möglicherweise verschärfenden pandemischen Situation.
Es ist verdienstvoll, dass der Landeskulturetat in den letzten vier Jahren von 200 auf über 315 Millionen Euro angewachsen ist. Dabei sind die Corona-Hilfen nicht berücksichtigt. Nun brauchen wir ein deutliches Signal zur Fortsetzung der Pandemiehilfe. Kultur ist Ländersache – und auch Länderverantwortung.
Umfrage Kunst und Kultur in der Pandemie
Mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen haben wir 2021 eine Untersuchung zum Thema „Kunst und Kultur in Pandemiezeiten in NRW“ vorgenommen. Darin fragten wir, inwieweit die Kulturwelt in Nordrhein-Westfalen mit veränderten Produktions- und Präsentationsformaten auf die Ausnahmesituation reagiert hat. Ein Ziel war es, übertragbare und zukunftsfähige Lösungsmodelle zu identifizieren und sichtbar zu machen. Eindrücklich war insgesamt, mit welcher Kreativität und Flexibilität die Künstler*innen im Land trotz aller Einschränkungen weiterhin Kunsterlebnisse schufen. Eine deutliche Mehrheit reagierte mit veränderten digitalen Formaten auf die neuen Herausforderungen. Hierbei gab es ein breites Spektrum an unterschiedlichen Lösungsansätzen sowohl in Produktion als auch in Präsentation, die in einem ausführlichen Kapitel zu Best-Practice dargestellt werden. Das Publikum begegnete dem Angebot dieser bislang zumeist ungewohnten Präsentationsformate mit Interesse. Auch wurden vielfach neue Zielgruppen erreicht. Weitere Themen der Umfrage waren die Bereiche Auslastung, Erlösmodelle, Corona-Schutzverordnung sowie ein Überblick über Wünsche an die Kulturpolitik in NRW.
Die kulturpolitische Entwicklung 2021
Es gab auf den verschiedenen Feldern zahlreiche Aktivitäten. Ich greife einige heraus:
Im November verabschiedete das Landesparlament in Düsseldorf das deutschlandweit erste Kulturgesetzbuch. Wir versprechen uns davon eine gute Grundlage für die Stärkung der Kultur an sich im Land sowie gegenüber anderen Politikbereichen. Voraussetzung ist, dass die in Aussicht genommenen Vorhaben ausreichend finanziert und die behördlichen Verfahren endlich entbürokratisiert werden. Das Kulturgesetzbuch ist eine Momentaufnahme. Es muss in der nächsten Legislaturperiode wieder auf die Tagesordnung und durch weitere Spezialregelungen aktualisiert werden.
Unsere Kulturkonferenzen Zukunft.KULTUR.NRW I + II im Mai und im Dezember erreichten mehrere Hundert Teilnehmende aus Kultur, Politik und Verwaltung. Sieben Querschnittsthemen wurden eingehend behandelt: „Wandel urbaner Kultur“, „Kultur in der Fläche“, „Zukunft von Kulturorganisationen“, „Kulturakteur:innen zwischen Förderung, Markt und Sozialpolitik“, „Digitale Transformation“, „Diversitätssensibilität“ sowie „Perspektiven für die Freie Szene“. Das partizipativ ausgerichtete Konzept führte zu einer regen Beteiligung an den im Nachgang der ersten Tagung gebildeten Arbeitsgruppen. Das Monitoring am 1. Dezember stellte die dort erarbeiteten Handlungsvorschläge zur Diskussion. Nun werden wir die Ergebnisse bündeln und daraus konkrete Forderungen an die politisch Verantwortlichen formulieren. Grundsätzlich stehen hierbei die strukturelle und finanzielle Unterstützung beim Wandel des Kulturbereichs im Fokus.
Im Vorfeld der Landtagswahl erarbeiteten die Sektionen des Kulturrats NRW ausführliche Wahlprüfsteine . Sie wurden von unserer Mitgliederversammlung beschlossen und zeigen die Perspektiven für die Kulturpolitik der nächsten Jahre auf. Wir werden dazu mit den kulturpolitischen Vertreter*innen und den Parteispitzen Anfang des neuen Jahres Gespräche führen.
Vernetzung
Um uns für kommende Diskussionen zu wappnen, haben wir zu Beginn des Jahres gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat eine neue Initiative ins Leben gerufen. Wir sind dabei, Landeskulturräte aller Bundesländer zu vernetzen bzw. ihre Bildung anzuregen. Geplant ist, u.a. eine jährliche Konferenz zur Behandlung sparten- und länderübergreifender Themen zu organisieren. Wir wollen den regelmäßigen Informationsaustausch und wir wollen Partner der neuen Kulturministerkonferenz der Länder werden, die ihre Rolle noch verstärken muss.
Und auch auf dem Feld der Medien waren wir aktiv. Seit Mitte des Jahres führen wir regelmäßige Gespräche mit den kulturaffinen Vertreter*innen in den Rundfunkräten der öffentlich-rechtlichen Sender. Zentrale Themen sind hier die anstehende Änderung des Medienstaatsvertrags und die stärkere Einbindung der Gremien in die Entscheidung der Anstalten. Die Strukturveränderungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die diskutiert werden, sind einschneidend und für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems wichtig. Die Mitgliedschaft einiger Kulturvertreter*innen auch im neu berufenen WDR-Rundfunkrat nutzen wir für diese Zwecke.
Jubiläum
2021 feierten wir unser 25-jähriges Bestehen. Das geplante Fest mussten wir zwar aus bekannten Gründen absagen, wir hoffen aber auf ein Gartenfest im Frühjahr. In unserer Jubiläums-Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Arbeit des Kulturrats NRW seit 1996.
Blick nach Berlin
Wenn es um Kulturpolitik geht, so blicken derzeit alle nach Berlin auf die neue Staatsministerin und auf die Koalitionsvereinbarung. Das ist verständlich, doch dieses Interesse darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kulturpolitik in den Bundesländern und in den Städten und Gemeinden konzipiert und finanziert wird. Es ist kein eigenes Ministeramt für Kultur geschaffen worden. Das für die Kultur zuständige Kabinettsmitglied ist der Bundeskanzler selbst. Er trägt, wie schon bisher, eine besondere Verantwortung. Wir erwarten von Berlin nicht nur kulturpolitische Exkurse, sondern handfeste Politik, mit der Kultur ermöglicht wird. Die finanziell sehr aufwendige Hauptstadt-Kulturpolitik sollte nicht so stark dominieren. Dazu muss Claudia Roth sich in den „Maschinenraum“ der Kulturpolitik begeben, also auf die Ebene der Kommunen und der Länder. Auch Bundeskulturpolitik muss dafür sorgen, dass die Kommunen, die die Hauptlast der Kulturförderung tragen, bei der Aufteilung der Staatsfinanzen, entlastet werden. Sonst werden wir empfindliche Haushaltseinsparungen erleben. Es ist zu begrüßen, dass Claudia Roth mitgeteilt hat, in Zukunft besser mit den Kommunen, den Ländern und den Verbänden in einem „strukturierten Austausch“ zusammenarbeiten zu wollen. Und ebenso ist zu begrüßen, dass sie die Verbesserung der sozialen Lage der Kulturschaffenden als dringend zu lösendes Problem sieht. Ulrich Khuon hat mit Recht darauf hingewiesen, dass eine Spaltung der Kultur verhindert werden muss. Eine Spaltung zwischen den gesicherten etablierten Strukturen und der Freien Szene, die vor allem in der Pandemie besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt ist.
Und noch eine Diskussion ist zu führen: Es mehren sich die Forderungen, der Kunst auch bei staatlicher Förderung, inhaltliche Vorgaben zu machen. Das braucht die Kunst nicht und das verträgt sie auch nicht. Kunst ist ein zweckfreier Raum des Denkens, sie ist „frei“, und zwar gegen alle Versuche, diese Freiheit einzuschränken, woher sie auch kommen. Etwas anderes ist es, etwa die Produktionsbedingungen am Klimaschutz zu orientieren.
Fazit
Alles in allem ist Kulturpolitik in unserem Lande im letzten Jahr gestärkt worden, durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft und seine Ministerin Pfeiffer-Poensgen, durch den Finanzminister Lienenkämper und nicht zuletzt durch den ehemaligen Ministerpräsidenten Laschet und Staatssekretär Liminski. Aber nicht weniger auch durch das Parlament und seine Kultursprecher, und durch den Kulturausschuss unter Leitung von Oliver Keymis, der dem nächsten Landtag leider nicht mehr angehören wird.
Auch der Kulturrat NRW ist stärker geworden. Unsere Anregungen, Initiativen Vorschläge, aber auch unsere Kritik finden mehr als nur Beachtung. Vieles konnten wir erreichen – gerade auch in ständiger Rückkoppelung zu unseren Verbänden. Neue Konzepte wurden erarbeitet. Ein lebhafter Diskurs fand statt.
Diese Entwicklung, die vor vier Jahren begann, muss fortgesetzt werden, wer auch immer nach dem Mai 2022 regiert.
Wir haben eine handlungsstarke Geschäftsstelle. Sie war im letzten Jahr besonders gefordert und verdient Dank und Anerkennung, also vor allem Catalina Rojas Hauser und Bernd Franke, Ola Stankiewicz und Katrin Gildemeister. Wir bedanken uns auch für die Unterstützung durch die RheinEnergieStiftung Kultur bei Herrn Dr. Steinkamp und Frau Prof. Hilger. Und noch eine Bemerkung: Der geschäftsführende Vorstand – das sind neben meiner Person Heike Herold und Reinhard Knoll – ist in seinem Amt für zwei weitere Jahre bestätigt worden.
Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass sich die schöpferischen Kräfte in unserem Lande unter angemessenen Rahmenbedingungen entfalten können. Kunst und Kultur sichern die geistige Überlebensfähigkeit unserer Gesellschaft – besonders jetzt in der Krise.
In diesem Sinn alle guten Wünsche für das neue Jahr!
Ihr Gerhart Baum