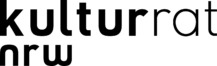Nachzuhören am 2. Oktober 2016 um 19:05 Uhr auf WDR3
Nachzuhören am 2. Oktober 2016 um 19:05 Uhr auf WDR3
Die Symbiose zwischen Kunst und Architektur ist immer weiter zurückgegangen, Kunst am Bau ist unter die Räder gekommen, so begrüßte Gerhart Baum eine große Schar von Interessenten an Kunst und Kultur im Kölnischen Kunstverein. Der Kulturrat NRW, dem er vorsteht, hatte zu einer Diskussion mit Dr. Claudia Büttner, Historikerin aus München, Sabine Gross, Ministerium für Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz, Ute Reeh, Künstlerin aus Düsseldorf und Oliver Keymis, Vizepräsident des Landtags NRW und Kulturpolitischer Sprecher der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, am 20. September 2016 eingeladen. Es moderierte Peter Grabowski.
Auf welcher Rechtsgrundlage bewegt sich das Prinzip, dass bei öffentlichen Bauten ein gewisser Kostenanteil in Kunst investiert werden muss? Kunst am Bau ist kein verfassungsrechtlicher Begriff, erläuterte Sabine Gross, sondern Gegenstand von Dienstanweisungen und Richtlinien. Die Ausgaben bewegen sich in Rheinland-Pfalz zwischen 25.000 und 250.000 Euro pro Kunstwerk je nach Größe des Bauwerks. Während in Rheinland-Pfalz Kunst am Bau geregelt ist, steht in NRW lediglich die Förderung von Kunst im Artikel 18 der Landesverfassung. Immerhin stellt Artikel 20 des Kulturfördergesetzes, das seit Anfang 2015 gilt, die öffentliche Aufgabe der Kunst am Bau. Doch ein wichtiges Thema der Landeskulturpolitik sei sie nicht, so Oliver Keymis.
Peter Grabowski bedauert die dadurch verpassten Wirkungen und erinnert an die „32 cars for the 20th century: play Mozart’s Requiem quietly“ von Nam June Paik, die 1997 vor dem Münsteraner Schloss in Achtergruppen standen und von denen einige tatsächlich eindrucksvoll das Requiem spielten. Wirkung zuhauf. Warum brauchen wir Kunst am Bau, fragt er Ute Reeh, die sich beruflich mit den Wirkungen von Kunst beschäftigt. Sie spiegelt das große Ganze, erläutert Reeh, der Künstler reflektiert gesellschaftliche Prozesse oder auch schlicht die Bauprozesse. Für Letzteres war die Entwicklung des Genres wichtig, sich weg vom Objekt und hin zum Prozessualen zu orientieren. Eine Performance setzt sich etwa mit der Bauentwicklung auseinander und nimmt unmittelbar auf sie Bezug.
Die Entwicklung driftete hier zwischen Objekt und Prozess auseinander, meint Claudia Büttner, und sie kommt wieder zusammen. Das Partizipatorische und Prozessuale spiegelt die Bauverwaltung und -entwicklung. Kunst am Bau sei letztlich Auftragskunst, die auch Lösungen von Bauproblemen offerieren könne. Als Beispiel nennt sie die Musikhochschule in Mainz, die eine Anlage in Hufeisenform hat und vor dem Problem stand, dass Erstbesucher Schwierigkeiten hatten, den Eingang zu finden. Der Künstler Jens Brand baute an die Stelle des fehlenden vierten Flügels des Gebäudes eine computergesteuerte mechanische Orgel in einer großen Glasvitrine. Sie begrenzt den Hof der Musikhochschule zur Straße hin und gibt architektonische Orientierung. Die Orgel ergänzt mittels eines digitalen Analyseverfahrens die Klänge aus den Überäumen der Hochschule mit langsam wechselnden Zweiklängen. Ihre Form zitiert in Proportion und Ansicht maßstabsgetreu die Architektur des Neubaus. Wird hier die Kunst nicht funktionalisiert? Ute Reeh sieht dies nicht als Problem, denn in aller Regel bringt der Künstler den Mut zum vollen Risiko in die Prozesse ein. Die Ergebnisse seien kaum kalkulierbar. Vielmehr entstehe Qualität mit offenem Ausgang.
Wie viele Mittel benötigt Kunst am Bau? Sabine Gross hatte in Rheinland-Pfalz 2015 zwei Projekte unter Kuratel. Die Ausgaben liegen dort jährlich zwischen 57.000 und 320.000 Euro jährlich. Sie empfindet prozentuale Regelungen als stabilisierend. Claudia Büttner hat die Bundesländer auf dem Stand von 2010 verglichen. Einige Länder wie etwa Niedersachsen haben sich 2003 aus der Förderung von Kunst am Bau zurückgezogen, Thüringen hat die Regelung 2004 aufgehoben. In Bayern hingegen betragen die Ausgaben ein bis zwei Millionen jährlich, in Baden Württemberg eine halbe Million. Die Unterschiede sind auffällig. In NRW sind Förderbeträge zuletzt 2014 abgerufen worden, seither nicht mehr, obwohl eine Haushaltsstelle vorhanden ist. 290.000 Euro beträgt der Gesamtetat in NRW. Claudia Büttner findet den Betrag zu niedrig. Hamburg etwa benötige etwa 250.000 Euro jährlich allein für Erhaltungsmaßnahmen. Keymis sieht den nordrhein-westfälischen Kulturetat als viel zu gering an, um mehr als das zu ermöglichen.
In den Jahren 2000 bis 2004 war das Engagement viel größer, erinnert sich Keymis. Da hatte das Land auch einen (grünen) Bauminister, der zugleich Kulturminister war. Das Kulturfördergesetz soll nun über den Einbruch hinweg helfen. Kunst am Bau ist dort als landeseigene Aufgabe definiert. Während der Bauliegenschaftsbetrieb NRW (BLB) die großen Bauprojekte steuert und vom Finanzministerium betreut wird, liegt die Zuständigkeit für Kunst am Bau künftig auch beim Kulturministerium mit der Kunstsammlung NRW. Dort ist Falk Wolf, der Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst, auch zuständig für Kunst im Landesbesitz und Kunst am Bau. Wichtig sei, dass das Land den Prozess reorganisiere und die Künstler einbeziehe.
Dafür wird Keymis nicht nur Beifall zuteil, zumal Claudia Büttner diese Struktur kritisiert: Man könne die Künstler nicht wirkungsvoll von außen her einbinden. Der Schlüssel sei die Bauverwaltung. Dort benötige man Ansprechpartner und Sachwalter für Kunst am Bau. Eine externe Zuständigkeit in der Kulturverwaltung habe sich nicht bewährt. Keymis widerspricht, der BLB arbeite mit den anderen Einrichtungen transparent zusammen. Dazu passt, so Grabowski und Reeh, dass sich in der Stadt Düsseldorf die Planungsdezernentin und der Kulturdezernent die neue Kunstbaukommission gegenseitig zuschieben. Sie besteht immerhin zur Hälfte aus Künstlern, doch integral ins Geschehen gelangt sie nicht. In München, so Büttner, gebe es gleichfalls Probleme, wenn das Kulturamt Ansprechpartner im Bau sucht.
Gross fordert von Entscheidungsstrukturen mehr Kommunikation und die Bereitschaft, Fachleute einzubinden und kunstaffine Architekten zu befragen. Am Anfang eines Vorhabens solle man viel Raum für Vorschläge lassen, im Wettbewerb müsse jeder subjektiv mitreden dürfen. Ute Reeh ergänzt, dass man die Baufachleute benötige und diese infizieren müsse. Keymis sieht ein großes Problem in der Gesellschaft selbst. Zu viele stünden der Kunst am Bau fremd gegenüber. Das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger muss geweckt werden.
rvz